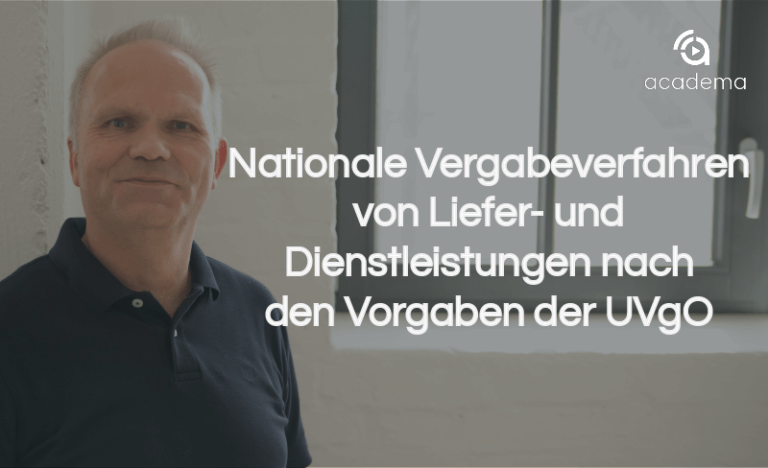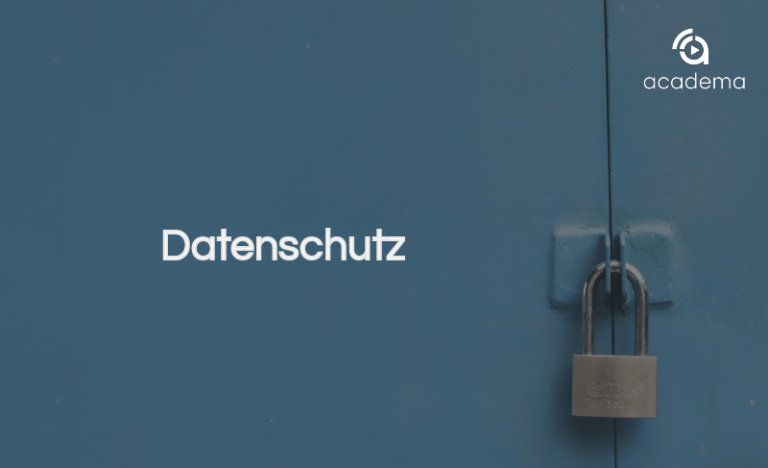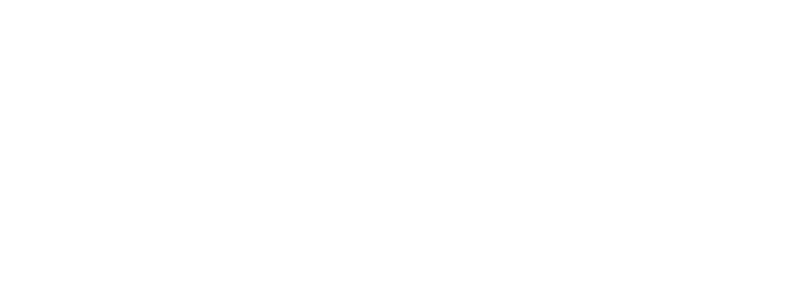EU-Projekte: Beantragung, Anforderungen und Prüfungssicherheit
Dieser Beitrag wird Ihnen von academa zur Verfügung gestellt. Unsere digitalen Weiterbildungsformate wurden speziell für Mitarbeitende in der öffentlichen Verwaltung entwickelt.
Verwaltungslexikon
EU-Projekte: Beantragung, Anforderungen und Prüfungssicherheit
Die Antragstellung
Die Beantragung findet über ein sogenanntes Participant Portal (Teilnehmerportal) statt. Die Registrierung hierfür erfolgt über den EU-Login, welcher den Zugang zu diversen Systemen der Europäischen Kommission bildet. Falls Sie bereits einen Zugang namens ECAS eingerichtet haben, ist dies kein Problem. Dies war die bisherige Lösung und wurde zuletzt auf den EU-Login umgestellt, wobei alle Daten ebenfalls auf den neuen Account übertragen wurden.
Die konkrete Antragstellung erfolgt durch den Koordinator und ist nur dann möglich, falls ein Participant Identification Code vorliegt (PIC). Dieser kann im Vorhinein durch juristische Personen, welche Forschungsgelder beantragen möchten, bei der EU angefragt werden.
Für eine Beantragung von EU- Projekten muss außerdem eine Person im eigenen Haus benannt werden, welche den Posten des Legal Entity Appointed Representative (LEAR) übernimmt. Ein:e LEAR ist verantwortlich für die Pflege und Richtigkeit aller Informationen in der Teilnehmerdatenbank. Er:Sie ist automatisch ein Team Member und muss im Antrag als ein solches neben den anderen für das Projekt eingeplanten Mitarbeitenden gelistet werden.
Als grobe Checkliste für die Antragstellung können folgende Punkte abgearbeitet werden:
- Oben genannte Teilnahmevoraussetzungen schaffen
- Projektidee & Konzeption
- Projektpartner identifizieren, Koordination planen
- Projekt- & Finanzstruktur entwickeln
- Antragsdokumente ausfüllen
- Alle Daten aller Teilnehmenden hinterlegen und angeben
- Elektronische Einreichung der Antragsunterlagen

Das geförderte Projekt
Der Start des Projektes erfolgt nach Bewilligung der Förderung. Falls es nicht anders geregelt wurde, ist der Projektstart der erste Tag des Monats, der auf das Inkrafttreten der Finanzhilfevereinbarung folgt. Dieser Zeitpunkt ist vor allem dafür relevant, damit überprüft werden kann, ob die getätigten Ausgaben tatsächlich durch den Fördergeber erstattet werden.
Weiterhin gilt der Grundsatz der Kofinanzierung, wonach der Fördergeldnehmer selbst einen Eigenanteil an den Kosten tragen muss. Die Höhe des Eigenanteils ist von der im Vorhin festgelegten Förderquote abhängig. Übernimmt der Fördermittelgeber beispielsweise nur 70 % der Projektkosten, müssen die verbleibenden 30 % selbst getragen werden.
Wichtig ist hier noch zu erwähnen, dass nur während der Projektlaufzeit angefallene, den Teilnehmenden entstandene, im Gesamtbudget ausgewiesene und für die Durchführung des Projekts erforderliche Kosten förderfähig sind.
Auch müssen förderfähige Kosten gemäß den intern geltenden Rechnungslegungsgrundsätzen erfasst werden, den steuer- und sozialrechtlichen Bestimmungen genügen und gemäß dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Effizienz getätigt worden sein.
Nicht förderfähige Kosten sind hingegen beispielsweise Kosten ohne Projektbezug oder Verluste durch variierende Wechselkurse.

Die Personalkosten
Um die Personalkosten abzurechnen und erstatten zu lassen, ist ein Timesheet (Stundenzettel) notwendig. Jede Arbeitskraft im Projekt muss einen Stundenzettel führen, der nur für das Projekt spezifisch gilt. Wirkt eine Person bei verschiedenen Projekten mit, muss für jedes ein einzelner Stundenzettel geführt werden. Nur mit einem solchen Nachweis werden die Personalkosten anerkannt.

EU-Projektformate: Digitale Weiterbildung mit academa
Die erfolgreiche Arbeit mit Fördergeldern des Horizon 2020 Förderprogramms erfordert viel Genauigkeit und Beachtung geltender Vorschriften.
Neben den oben genannten Punkten sind noch einige weitere Details relevant. Um diese zu verstehen und sicheren Umgang zu ermöglichen, kann der academa Onlinekurs “EU-Projektformate – Von der Einwerbung bis zur Abrechnung” mit Frau Dr. Andrea Greven zur Hilfestellung genutzt werden.
Sehen Sie sich hier eine Lerneinheit aus dem Onlinekurs an!
Wenn Sie den vollständigen Demokurs mit allen Funktionen, wie Selbstlernfragen und Austauschforum, nutzen möchten, klicken Sie bitte auf die blaue Schaltfläche „Zum vollständigen Demokurs“.
Diesen Beitrag teilen:
Dr. Andrea Greven

Entdecken Sie alle Onlinekurse von academa und finden Sie die passende Weiterbildung für Ihren beruflichen Erfolg!
Nationale Vergabeverfahren von Liefer- und Dienstleistungen nach den Vorgaben der UVgO
Die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) regelt die öffentliche Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen, sofern der Auftragswert unterhalb der EU-Schwellenwerte liegt. In diesem Onlinekurs lernen Sie, neben den relevanten Rechtsgrundlagen der (UVgO), die praktische Umsetzung und Anwendung dieser im Arbeitsalltag von Beschafferinnen und Beschaffern. Ihr Referent Herr Temmen blickt auf über 38 Jahre Berufserfahrung in der öffentlichen Beschaffung zurück und bringt Ihnen diese Expertise in zahlreichen Praxisbeispielen verständlich näher.
Datenschutz
- Datenschutz in der Personalabteilung
- Mitarbeiterschulung „Grundlagen des Datenschutzes“
- Sicher im Homeoffice
Grundlagen der Finanzbuchhaltung (inkl. Doppik)
Dieser Kurs bietet eine umfassende Einführung in die Finanzbuchhaltung für kommunale Einrichtungen. Sie werden lernen, wie man die Elemente der kommunalen Buchhaltung versteht und anwendet, die Funktionsweise des öffentlichen Abschlusses versteht und die speziellen Elemente der öffentlichen Buchführung beherrscht. In diesem Kurs werden wir uns auf die wichtigsten Aspekte der Finanzbuchhaltung konzentrieren, die für kommunale Einrichtungen relevant sind. Sie erhalten sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Anwendungen. Sie werden lernen, wie man eine korrekte Buchführung durchführt, wie man Finanzdaten analysiert und wie man Finanzentscheidungen trifft. Dieser Kurs ist perfekt für alle, die in kommunalen Einrichtungen arbeiten oder sich für eine Karriere in diesem Bereich interessieren. Lassen Sie uns gemeinsam die Grundlagen der Finanzbuchhaltung erlernen.