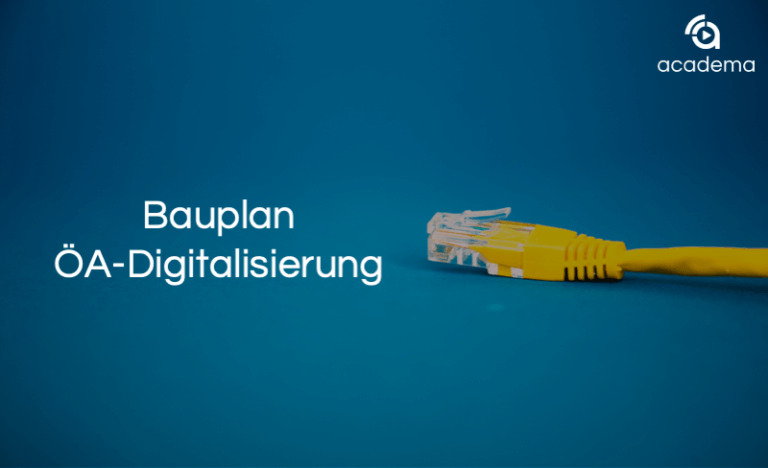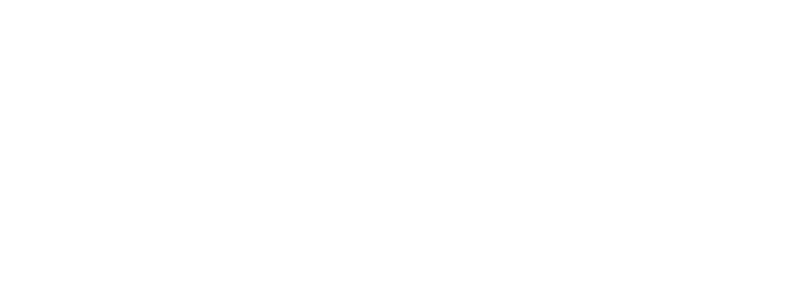Grundlegendes Wissen zur Administration von Drittmitteln
Dieser Beitrag wird Ihnen von academa zur Verfügung gestellt. Unsere digitalen Weiterbildungsformate wurden speziell für Mitarbeitende in der öffentlichen Verwaltung entwickelt.
Verwaltungslexikon
Grundlegendes Wissen zur Administration von Drittmitteln
Internes Kontrollsystem
Wer revisionssicher Drittmittel verwalten möchte, kann durch ein internes Kontrollsystem (IKS) große Teile des Prozesses vereinfachen. Ein IKS umfasst Grundsätze, Verfahren und Maßnahmen, um unter den maßgeblichen rechtmäßigen Vorschriften zu handeln. So können auch Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der internen und externen Rechnungslegung sichergestellt werden – alles mit dem Ziel einer revisionssicheren Administration. Wie genau das hauseigene IKS aussieht, kann intern entschieden werden.
Folgende Punkte sind jedoch besonders wichtig um eine ordnungsgemäße Drittmittelverwaltung sicher zu stellen:
- Vermeidung von Doppelförderungen (“keine Ausgabe darf doppelt abgerechnet werden”, sog. Verbot der Doppelförderung)
- Einhaltung beihilferechtlicher Vorschriften (z. B. Trennungsrechnung zur Vermeidung von unrechtmäßigen Subventionen zwischen wirtschaftlichem und nicht wirtschaftlichem Bereich)
- Vermeidung fehlerhafter steuerrechtlicher Einordnungen von Zuwendungen (z. B. kein Ausweis von Mehrwertsteuer bei Leistungsaustausch)
Die Einführung regulärer Abläufe und Kontrollen bildet die Grundlage für das interne Kontrollsystem. Informationsabruf, Risikobeurteilung, Kontrolle und Überwachung sind also wichtige Komponenten des IKS, welche eine revisionssichere Arbeit im Bereich Drittmittel unterstützen.

Akteure und Schnittstellen im Drittmittelprozess
Im Drittmittelprozess gibt es in der Regel viele verschiedene Akteure und Schnittstellen (z.B. Antragstellung, inhaltliche Bearbeitung, Buchhaltung). Für die Organisation von der Beantragung bis zum Abschluss eines Projektes ist klarzustellen, welche Prozessschritte welcher Zuständigkeit unterliegen. Darüber hinaus gibt es zwingende steuerliche und rechtliche Vorgaben, wie z.B. das EU-Beihilferecht, diverse Förderrichtlinien und das Vergaberecht öffentlicher Einrichtungen.
Prozess und Abläufe sind gegenüber den zwingenden rechtlichen Vorgaben gestaltungsfähig. Zum Beispiel die Administration auf Seiten der Wissenschaft, intern gewählte Dokumentationssysteme und die Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Fördergeber. Jeder Fördergeber hat jedoch eigene Ansprüche und Systeme, welche voneinander abweichen können.
Eine große Rolle für die Gestaltungsfähigkeit der eigenen Prozesse im Drittmittelmanagement spielt die Digitalisierung. Diese bietet einige Chancen, um Arbeiten (z. B. Dokumentationen) einfacher und schneller zu gestalten (z. B. durch die Einführung einer elektronischen Drittmittelakte).

Qualitätssicherung im Drittmittelmanagement und Projektlebenszyklus
Zum Aufbau von Revisionssicherheit müssen noch nicht ausgereifte Prozessschritte angepasst werden, um den Ablauf zielorientiert zu gestalten – alles unter Berücksichtigung des Mottos “Ausrichtung am Projektlebenszyklus”.
Die Ausrichtung am Projektlebenszyklus berücksichtigt die folgenden Fragen:
- Was wird in welchem Projektschritt benötigt?
- In welchem Bereich gibt es noch Gestaltungsspielraum?
- Wie kann ich den Gestaltungsspielraum bestmöglich für mein Drittmittelmanagement organisieren?
- Welche “Stolperfallen” gibt es und welche Lücken gibt es ggfs. in der Prozessdokumentation?
- Sollten Zuständigkeiten der Mitarbeitenden neu definiert werden?
Für die Ausrichtung am Projektlebenszyklus braucht es langfristige Lösungen, zum Beispiel eine zentrale Anlauf- und Controllingstelle und die Einführung einer elektronischen Akte. In jedem einzelnen Schritt des Produktlebenszyklus stecken Verbesserungspotentiale für das Drittmittelmanagement.
Bei der Projektidee kann z. B. eine elektronische Antragsdatenbank zur Übersicht und Abgleich mit anderen Projekten dienen. Bei einer Förderzusage würde dann wiederum eine Rückkopplung mit einer Antragsdatenbank greifen, welche die Prozessschritte verknüpft und ein Übersehen von Informationen verhindert.
Nach dem Start des Projektes helfen beispielsweise eine Prüfung von Abrechnungsunterlagen zu Sicherheit und können in einem wiederkehrend angewandten Workflow resultieren. Kommt ein Projekt zum Abschluss, sollten Erfahrungen und Erkenntnisse für nachfolgende Projekte dokumentiert werden, egal ob positiver oder negativer Natur.
Alle kleinen und großen Anpassungen und Verbesserungen werden das hauseigene IKS stetig verändern, bis optimale Prozesse entstanden sind, welche natürlich von Fördergeber zu Fördergeber verschieden sein können. Die Etablierung von Qualitätsstandards sollte immer das Ziel sein.

Prüfungsrechte
Der Erhalt von Fördermitteln ist abhängig von organisationsinternen und organisationsexternen Prüfungsinstanzen. Dabei wird zunächst der Projektantrag von diesen Instanzen geprüft. Eine interne Instanz ist z. B. die interne Revision oder die drittmittelverwaltende Stelle; die externe Instanz ist in der Regel der Zuwendungsgeber.
Nach erfolgreicher Antragstellung und Erhalt der Fördermittel kann die Durchführung des Projektes sowie die Abrechnung der Fördermittel auf verschiedene Arten geprüft werden. Zum einen gibt es die Stichprobenprüfung, die einzelne Sachverhalte “stichprobenartig”, wie zum Beispiel Ausgabenarten und einzelne Zeiträume des Projektes, untersucht. Zum anderen gibt es die Vollprüfung/-erhebung, bei welcher alle Belege und Dokumente des gesamten Projektzeitraumes geprüft werden.
In beiden Fällen kann entweder die Methodik der “Schreibtischprüfung” (postalischer Versand aller benötigten Belege, Dokumente als Kopie an den Fördergeber) oder die “Vor-Ort-Prüfung” (Projektbegehung, Originalbelege, Interview, Aktenkontrolle) angewandt werden.
Bei einer Beanstandung im Rahmen von Prüfungen können unterschiedliche Konsequenzen folgen. Die Form und Härte ist von den jeweiligen Umständen der Fehler in dem Projekt abhängig. In gravierenden Fällen kann es zu einer Rückforderung der Fördermittel oder auch zu strafrechtlichen Konsequenzen kommen. Durch Erfahrungswerte haben sich für einzelne Fördergeber verschiedene Anforderungen ergeben, auf die insgesamt bei der Verwaltung von Drittmitteln geachtet werden sollte. Es ist beispielsweise wichtig, Anlagen projektspezifisch zu inventarisieren, förderspezifische Vorgaben für die Verausgabung zu berücksichtigen und Personal den Projekten zuzuordnen (und dort auch zu verbuchen).
Bei vielen Projektformaten (u. a. EU) ist die Zeiterfassung der Projektmitarbeitenden verpflichtend. Auch die Dokumentation von Dienstreisen (ggfs. ins Ausland) ist sorgfältig durchzuführen und ggfs. auch gesondert beim Fördergeber genehmigen zu lassen. Darüber hinaus sind z. B. auch Mehrarbeiten in Projekten zu begründen und die Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes zu berücksichtigen.
Weitere wichtige Punkte sind:
- Unteraufträge im Rahmen von Projekten haben oft eine vergaberechtliche Relevanz (Beachtung des öffentlichen Vergabe- und Auftragswesens)
- Die jeweiligen Zuwendungsbedingungen sind zwingend zu beachten!
- Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung müssen immer beachtet werden.

Drittmittelmanagement: Digitale Weiterbildung mit academa
Für eine revisionssichere Administration von Drittmitteln ist einiges an Wissen, Systematik und Ausdauer gefragt. Die oben genannten Punkte können helfen, sich einen ersten Überblick über den Aufbau eines erfolgreichen Drittmittelmanagements zu verschaffen. Wenn Sie sich näher für das Thema interessieren und einen tieferen Einblick in die Drittmittelverwaltung erhalten möchten, nutzen Sie unseren Onlinekurs “Drittmittelmanagement Grundlagen” mit Frau Dr. Andrea Greven.
Sehen Sie sich hier eine Lerneinheit aus dem Onlinekurs an!
Wenn Sie den vollständigen Demokurs mit allen Funktionen, wie Selbstlernfragen und Austauschforum, nutzen möchten, klicken Sie bitte auf die blaue Schaltfläche „Zum vollständigen Demokurs“.
Diesen Beitrag teilen:
Dr. Andrea Greven

Entdecken Sie alle Onlinekurse von academa und finden Sie die passende Weiterbildung für Ihren beruflichen Erfolg!
Steuerrecht in Hochschulen: Grundlagen der Umsatzbesteuerung
Die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand hat vor allem durch das Steueränderungsgesetz (seit 2017 in Kraft) zahlreiche Änderungen erfahren. Dieser Onlinekurs nähert sich systematisch und von grund auf der Thematik der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand. Angefangen bei der allgemeinen Systematik der Umsatzsteuer, über den häufig diskutierten §2b UStG bis hin zum steuerbaren Leistungsaustausch, Steuerbefreiungs- und Ermäßigungstatbeständen und dem Vorsteuerabzug, deckt dieser Kurs alle relevanten Themen in dieser Thematik ab.
Ihre Referentin Dr. Jana Keller vereint dabei einerseits die rechtliche Sichtweise durch Ihre Tätigkeit als Rechtsanwältin mit sinnvollen Praxistipps aus Ihrer damaligen Anstellung in der öffentlichen Verwaltung.
Bauplan ÖA-Digitalisierung
Gemeinsam mit der RWTH TIM wurde ein strukturiertes Vorgehensmodell für komplexe Digitalisierungsprojekte inklusive des Verweises auf wichtige weiterführende Dokumente entwickelt.
Gerade in der Abstimmung mit den Beteiligten – u. a. Sachaufwandsträger, Schulleitung, IT-Koordinatoren, Lehrkräften – schafft ein visualisiertes Modell Transparenz und damit Sicherheit im Vorgehen.
Wichtige Gates erleichtern den Übergang je Prozessphase, schließen Arbeitspakete ab und schaffen die Basis für den nächsten Abschnitt.
Der ÖA-Bauplan ist als Arbeitsmaterial konzipiert. Im Projektvorgehen können so entlang des Prozesses Stakeholder angemessen begleitet und die Arbeitsvorbereitung für den anstehenden Prozessschritt durchgeführt werden
Ordnungswidrigkeitenrecht: Grundlagen für fachfremde Abteilungen, Ämter und Dezernate
Neben dem Ordnungsamt haben zahlreiche weitere Abteilungen und Ämter bußgeldrechtliche Befugnisse, die immer wieder Teil des eigentlichen Tagesgeschäfts sind. Dieser Onlinekurs ist speziell für die Mitarbeitenden in Abteilungen und Ämter konzipiert, deren Haupttätigkeit nicht die Ordnungswidrigkeiten selbst sind, dennoch häufig mit diesen konfrontiert sind und daher ebenso eine hohe rechtliche Kompetenz im Ordnungswidrigkeitenrecht aufweisen müssen.
Ihr Referent Prof. Dr. Bijan Nowrousian ist Professor für Strafrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung und bringt Ihnen in diesem Onlinekurs prozessorientiert die notwendigen und praktischen Handgriffe für Ihren Arbeitsalltag nahe.